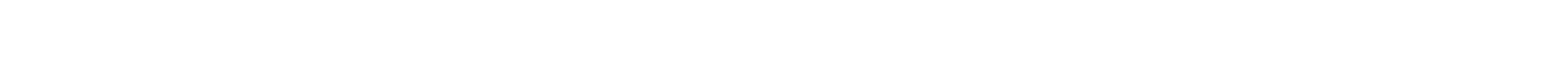Möbel & Interieur
Als das Gut 1994 wieder privatisiert wurde, befanden sich im Herrenhaus keine historischen Möbel mehr. Jedoch sind die Stuckdecken und die Wandgestaltung im Rittersaal erhalten geblieben, sodass Stil und Flair der Erbauungszeit gut in das Interieur übernommen werden konnten. Die Neueinrichtung sollte jedoch keine homogene Ausstattung des beginnenden 18. Jahrhunderts rekonstruieren. Vielmehr zeigen Möbel und Interieur ein Spektrum, wie es nach vielen Generationen vorherrschen würde.
Die meisten Stücke sind aus der Haupteinrichtungszeit der Erbauung 1710 und der folgenden Jahrzehnte, also aus dem Barock und Rokoko. Jedoch hat man immer auch liebgewonnene, ältere Möbel weiterhin genutzt und eingebunden. Daher gibt es auch Beispiele aus dem späten Mittelalter und der Renaissance. Natürlich kommen im Laufe der Zeit neue Ausstattungsstücke hinzu, so dass ein Konglomerat der verschiedenen Stile vom 15. bis zum 20. Jahrhundert entstand.
Viele Möbel konnten im Oktober 1995 aus der verauktionierten Sammlung der Markgrafen und Großherzöge von Baden Baden ersteigert werden. Andere stammen aus Familienbesitz oder fanden ihren Weg auf unterschiedliche Weise nach Hohen Luckow. Tauchen Sie ein in 500 Jahre Möbelgeschichte beim Rundgang durch die Räume.
Behältnismöbel
Mit der Sesshaftwerdung machten sich die Menschen Gedanken, ihr Hab und Gut praktisch und sicher zu verwahren. Archäologische Funde aus der Pharaonenzeit belegen eine Möbelschreinerei um 1500 v.Chr., wodurch weit entwickelte Kenntnisse im Drechseln, Furnieren, Intarsieren und Bemalen überliefert sind. Aus der römischen Zeit sind ebenfalls Interieure und ihre Darstellung auf Wandmalereien bekannt.
Truhen waren lange am verbreitetsten, weil sie gut transportiert werden konnten. Schränke entwickelten sich im 16. Jahrhundert aus zwei übereinander gestellten Truhen, die später zu einem einheitlichen Korpus mit durchgehendem Innenraum wurden. Diese beiden Behältnismöbel dienten der Aufbewahrung sakraler, amtlicher oder persönlicher Dinge. Die Kommode entwickelte sich im 17. Jahrhundert ebenfalls aus der Truhe. Sie war durch Schubfächer nun von vorn zu öffnen, wogegen der einst aufklappbare obere Abschluss jetzt verschlossen war und als Abstellfläche genutzt werden konnte. Dem Sekretär kam im Studier- oder Schreibzimmer eine besondere Funktion zu, weshalb er aufwändig furniert ist.
Tische & Stühle
Im Vergleich zu Schränken, Truhen und Betten entstanden Tische als eigenständiger Möbeltyp relativ spät. Bis zur Spätgotik baute man sie nach Bedarf auf und ab, bestehend aus einfachen Böcken und Brettern, über die man Stoffbahnen legte. Nach dem Mahl wurde »die Tafel aufgehoben«. Im 15. Jahrhundert entstand der dauerhaft im Raum stehende Gebrauchstisch mit seinen Unterarten: Wangen-, Bock-, Klapp-, Auszieh-, Stollen-, Kasten- und Säulentisch. Besondere Formen sind große Dielentische mit steinernen und Teetische mit keramischen Platten sowie Spieltische mit intarsierter Feldeinteilung oder reicher Ornamentik. Konsoltische stehen an der Wand und dienen mehr der Zierde als der Nutzung. Alle diese Typen sind im Herrenhaus vertreten.
Auch die historischen Sitzmöbel weisen hier ein großes Spektrum auf – vom hölzernen Schemel und der rustikalen Stabelle über schwere Armlehnstühle bis hin zu weich gepolsterten Sesseln und mehrsitzigen Banquetten. Ergänzend bietet der Parkrundgang vielfältige, von Künstlern gestaltete Sitzgelegenheiten. Alle sollten unbedingt probiert werden!
Spiegel
Seit 3000 Jahren benutzen Menschen Spiegel. Zuerst bestanden sie aus polierten Bronze- und Kupfertafeln. Im Mittelalter setzte sich metallbeschichtetes Glas durch. Zunächst brachte man eine dünne Zinnfolie mit Quecksilberbelag, später eine Silberschicht auf, die zwar erst einmal besser spiegelte, aber schnell dunkel anlief. Heut ist Aluminium das bevorzugte Material – ausdauernder, preiswerter und gesünder.
Die Größe der Spiegel wuchs mit den Herstellungsmöglichkeiten. Ursprünglich waren es kleine Glaskugelsegmente. Erst im 17. Jahrhundert konnte dünnes, glattes Flachglas bis 1,5 m hergestellt werden. Nun wurden Wandspiegel zu einem neuen ›Architekturelement‹, das den Raum erweiterte und das Licht reflektierte. Höhepunkt waren die Spiegelkabinette ausgehend vom Hofe Ludwig XIV. Hier im Herrenhaus gibt es viele Beispiele.
Leuchter & Laternen
Helligkeit in Behausungen zu bringen und auch die dunklen Stunden zu nutzen, war seit der kontrollierbaren Anwendung des Feuers ein zentrales Thema. Zuerst war es die Brandstelle selbst, dann Fackeln und Öllampen und seit fünf Jahrtausenden Kerzen. Im späten 18. Jahrhundert bediente man sich des Petroleums, gegen 1850 nutzte man bevorzugt Gas und dann Glühbirnen. Das Spektrum der Leuchten in Hohen Luckow reicht von Kerzenstöcken und Hallenlaternen bis zu pompösen, vielarmigen Deckenleuchtern.
Stuck
In allen Räumen des Herrenhauses hat sich der Stuck aus der Erbauungszeit erhalten. Am imposantesten ist er in den großen Räumen, die der Repräsentation dienten (Rittersaal und Ulmer Salon). Ein wahrer Meister seines Metiers war der Stuckateur Giovanni Battista Clerici, der aus dem Tessin kam und von Auftrag zu Auftrag durch Deutschland gerufen wurde. In Norddeutschland war er insbesondere in Hamburg, Schwerin und im Berliner Raum tätig. Selten ist ein Stuckensemble so geschlossen und gut erhalten geblieben wie in Hohen Luckow.
Clerici verwandte für seine Gestaltungen zeitgleiche grafische Vorlagen von seinem Landsmann Carlo Maria Pozzi, deren Motive er in Ausschnitten übernahm und teilweise in dreiviertelplastische Stuckfiguren und Ornamenten verwandelte. Pozzis Familie war über sechs Generationen als Bau- und Maurermeister, Stuckateure, Bildhauer und Maler tätig und bestens in den Bautrupps am Mittelrhein, Kassel, Fulda, Ellwangen u. a. Orte sowie in Norddeutschland und Dänemark vernetzt. Er zählte zu den bestbezahlten und meistbeschäftigten Stuckateuren seiner Zeit.
In Kopenhagen zeichnete Pozzi ein Stichwerk, das 1708 in Augsburg von Johann August Corvinus gestochen und durch Jeremias Wolf veröffentlicht wurde und ihn weit über seine eigenen Stuckarbeiten bekannt machte. Pozzi steht für den Übergang vom plastisch-flächenfüllenden geprägten Stuck des italienischen Hochbarocks zum französischen Régence-Stil. Nach seinen Vorlagen entstand ein herausragendes und zugleich typisches Beispiel adliger Wohnkultur und barocken Lebensgefühls. Vergleichbare Decken finden sich in den Schlössern Mirow, Glienicke und Köpenick.